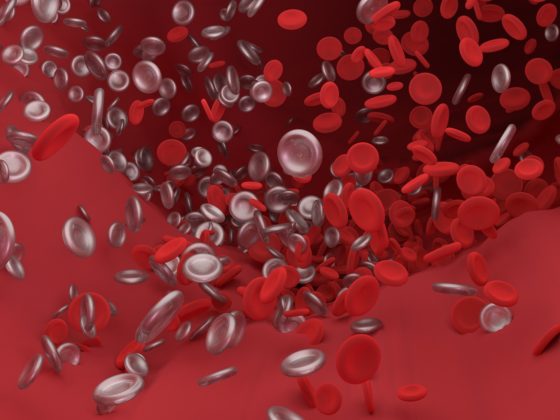Die Corona-Pandemie hat den Alltag für die Bewohner:innen der Südtiroler Seniorenwohnheime grundlegend verändert. Eine Studie des Instituts für Allgemeinmedizin zeigt, wie sich die Isolation auf Bewohner:innen, Angehörige, Mitarbeiter:innen und Hausärztinnen und Hausärzte ausgewirkt hat.

Die Maßnahmen zum Infektionsschutz haben gewohnte Routinen, Arbeitsabläufe, Alltagsstrukturen, Beziehungsmodelle und auch zahlreiche Grundwerte der bedürfnisorientierten Pflege und Sterbebegleitung zum Großteil außer Kraft gesetzt. Das Institut für Allgemeinmedizin der Claudiana hat unter der Studienleitung von Dr.rer.biol.hum. Barbara Plagg und in Zusammenarbeit mit dem Forum Prävention die qualitative Studie „Seniorenwohnheime in Isolation“ durchgeführt. Die Studienergebnisse wurden am 16. April vorgestellt.

Was bedeutet Gesundheit? Was ist erlaubt, wie weit darf man gehen, damit die Gesundheit geschützt ist und wo sperren wir wirklich Menschen ein und gehen über die Bedürfnisse von Menschen hinweg?“ (Hausarzt)
Nachdem eine wissenschaftliche Publikation des Instituts bereits im Mai 2020 das präventivmedizinische und ethische Dilemma in den Seniorenwohnheimen in Isolation aufzeigte, sei eine qualitative Erhebung nötig geworden, erklärt Prof. Klaus Eisendle, Präsident der Claudiana. Zwischen September und Dezember 2020 wurden 45 teilstrukturierte Interviews unter den ärztlichen Leiter:innen der Seniorenwohnheime, dem Pflegepersonal, den Bewohner:innen und den Angehörigen durchgeführt. Insgesamt sind so 637 Seiten anonymisiertes Interviewmaterial zur Datenanalyse zusammengekommen.
Studienergebnisse
Es kann sich kein Mensch vorstellen, wie ich das erlebt habe. Andere sagen, es war nicht so schlimm, man hatte Essen und Trinken und alles gehabt. Ja, hat man schon gehabt, aber die Freiheit ist das höchste Gut“. (Heimbewohner)
Die Interviews zeigen, dass die Bewohner:innen der Heime auf alt bewährte Strategien speziell aus ihrer entbehrungsreichen Kindheit zurückgriffen, um die Isolation auszuhalten. „Dennoch kamen viele Bewohner:innen mit der Isolation nicht zurecht und soziale, kognitive, psychische und körperliche Auswirkungen wurden bereits nach den ersten Wochen des Lockdowns deutlich,“ sagt die Studienleiterin Dr. Barbara Plagg. Während aufgrund der Maßnahmen Infekte in den Heimen insgesamt abgenommen haben, bestätigt die Studie die Zunahme nicht-infektiöser Pathologien: Durch die fehlende Stimulation wurde ein sprachlicher, geistiger und motorischer Abbau bei den Bewohner:innen sukzessive deutlich.
Meine Mutter überlebt hier, aber sie lebt nicht mehr. (Angehörige)
Neben der gesteigerten Orientierungslosigkeit, der Zunahme apathischer und verwirrter Zustände, sowie Stürzen aufgrund fehlender Mobilisierung, wird von einer Zunahme von Depressionen, Psychosen, Angststörungen, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen berichtet, die z.T. mit einer erhöhten Bedarfsmedikation einhergingen. „Insgesamt variierte die konkrete Vorgehensweise zwischen den einzelnen Einrichtungen, wir haben unterschiedliche Situationen vorgefunden,“ stellt Dr. Plagg fest, „doch eines hatten alle Fachkräfte gemeinsam: Schwere Gewissenskonflikte und Angst, sich im Spannungsfeld zwischen Maßnahmen zum Infektionsschutz, den ethischen Grundsätze der Pflege, möglichen strafrechtlichen Konsequenzen und der Verantwortung gegenüber dem Patientenwohl nicht richtig zu verhalten.“
Was man macht, ist falsch. Wenn man nichts gemacht hätte, keine Isolationsmaßnahmen, wäre es verwerflich oder – ja, wäre falsch gewesen, und auch so ist es ganz, ganz schwierig. Aber je mehr man da den Heimen individuellen Spielraum lässt, desto mehr kann man gerade auch auf die Würde eingehen. (Hausarzt)
„Die befragten Gruppen schienen besser mit der Ausnahmesituation zurecht zu kommen, wenn in den leitenden Positionen der Heime eine gemeinsam geteilte ethische Haltung gefunden werden konnte“, sagt Dr. Peter Koler vom Forum Prävention. Dies schien besser zu gelingen, wenn in der Handhabe eine gewisse Autonomie der Häuser bestand bei weniger, dafür umso deutlicheren und klar formulierten zentralisierten Anweisungen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen wurden zumeist durch individuelle Lösungsstrategien und hausinterne Regelungen der eigenen Struktur angepasst (z.B.: Besuche am Sterbebett mit Schutzausrüstung). Aber auch positive Dynamiken konnten für einige Heime in dieser Zeit festgestellt werden: So wurde beispielsweise der Austausch im Team intensiviert, Pflegekräfte zeigten hohe Motivation und Bereitschaft, Hausärzte und Hausärztinnen leisteten viele Überstunden und auch längst geforderte Maßnahmen, wie die Digitalisierung, konnten vorangebracht werden.
Ich muss sagen, ich habe oftmals die Regeln gebrochen. (Pflegekraft)
„Viele Seniorenwohnheime waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Pandemie ohne ärztliche Leitung,“ sagt Dr. Giuliano Piccoliori. „Das stellte sich als Problem dar, da es sich nun nicht nur um eine theoretische Funktion, sondern um eine wichtige Position mit viel Verantwortung handelte, erklärt Piccoliori. Die ärztliche Verantwortung war immer mit einem gewissen Restrisiko, wie auch mit Angst und Belastung verbunden. Die Kommunikation der Empfehlungen, Richtlinien und Maßnahmen unterschiedlicher Gremien gelang nicht immer, vieles ist von oberer Ebene nicht zu den beteiligten Fachkräften durchgedrungen.
Die Angehörigen zeigten in den Interviews Verständnis für die Ausnahmesituation, sie erwähnten aber besonders für die erste Zeit der Pandemie ein starkes Gefühl der Hilf- und Machtlosigkeit, das mit dem Fortschreiten der Situation und immer weniger nachvollziehbaren Maßnahmen zunahm.
Für mich ist das oft schon schwer zu ertragen gewesen. Dass wir jetzt die Angehörigen ersetzen, dass wir jetzt die sind, die jetzt da daneben sitzen und sie am letzten Weg begleiten, obwohl eigentlich draußen eine Tochter oder ein Sohn sitzt, dem das eher zustehen würde. (Pflegekraft)
Ein besonders negatives Erlebnis für Fachkräfte wie für Angehörige war der veränderte Sterbeprozess und der Umgang mit den Leichen, so Studienleiterin Plagg. „In einigen Seniorenwohnheimen wurde den Angehörigen der Zugang zu sterbenden Bewohner:innen verwehrt, andere setzten sich in dieser Situation über das Besuchsverbot hinweg, allerdings nicht ohne Schutzmaßnahmen.“ Die fehlenden oder veränderten Sterberituale sorgten bei allen Beteiligten für ein maßgebliches Belastungserleben, insbesondere bei jenen Angehörigen, die sich von ihren Familienmitgliedern nicht verabschieden konnten.
Handlungsstrategien:
„Die Studie hat zahlreiche Konflikte und Fragen aufgezeigt, die bis dato nicht zufriedenstellend gelöst sind, daher muss sich eine interdisziplinäre Fachgruppe mit den beschriebenen Schwierigkeiten auseinandersetzen,“ fordert der Präsident des Instituts Dr. Adolf Engl. Insgesamt sollen durch die Zusammenarbeit von Mitarbeiter:innen, Bewohner:innen und Angehörigen die Seniorenwohnheime partizipativer gestaltet und organisiert werden. Gleichzeitig bedarf es ausreichend personeller Ressourcen und angemessener Honorierung. „Das ist ein langfristiger notwendiger gesellschaftlicher Diskurs, der geführt werden muss,“ sagt Studienleiterin Dr. Plagg. Unmittelbar hingegen müssen Heime für Angehörige geöffnet werden und die Begleitung Schwerkranker und Sterbender durch ihre Familien prinzipiell und in jedem Fall gewährleistet sein. „Fundierte ethische Grundsätze der Pflege und Versorgung von Patient:innen“, so die Studienleiterin, „dürfen auch und ganz besonders im Katastrophenfall nicht verhandelt werden.”
Kontakt Studienleitung:
Dr.rer.biol.hum. Barbara Plagg: barbara.plagg@am-mg.claudiana.bz.it