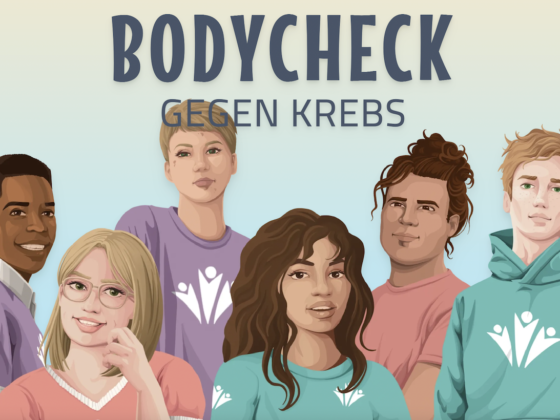Die psychischen Langzeitfolgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche sind noch immer spürbar. Die COP-S-Studie („Corona und Psyche in Südtirol“), die in den letzten Jahren beunruhigende Entwicklungen dokumentierte, geht nun in die vierte Erhebungsphase. Vom 24. März bis zum 13. April 2025 können Eltern und Jugendliche wieder einen Online-Fragebogen ausfüllen.

Die Ziele der Erhebung 2025
,COP-S‘ steht für ,Corona und Psyche in Südtirol‘. Die vierte COP-S-Erhebung legt ihr Augenmerk auf die langfristigen psychosozialen Auswirkungen der Pandemie. „Die Daten der bisherigen Erhebungen zeigen klar, dass psychosomatische Beschwerden sowie Hinweise auf Angststörungen und Verhaltensauffälligkeiten auch nach der Pandemie nicht zurückgegangen sind – teilweise sind sie sogar angestiegen“, betont Dr. Verena Barbieri, Biostatistikerin am Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen und Leiterin der COP-S-Studie. In Deutschland zeigen neueste Studienergebnisse, dass Hinweise auf Angststörungen und Depressionen im Vergleich zur Zeit vor der Coronakrise signifikant zugenommen haben. In der diesjährigen COP-S-Erhebung, die wieder mit Unterstützung der Schulämter aller drei Sprachgruppen durchgeführt wird, werden vor allem die Auswirkungen von Digital Media auf die mentale Gesundheit, der Zusammenhang zwischen schulischer Belastung und psychischem Wohlbefinden sowie der Einfluss familiärer Faktoren auf die Psyche untersucht. Zudem sollen gezielt Schutzfaktoren benannt werden, die eine psychische Resilienz bei Jugendlichen fördern können. „Untersuchungen legen nahe, dass übermäßige Nutzung digitaler Medien mit psychischen Belastungen wie Depressionen, Angststörungen und Schlafproblemen einhergehen kann“, sagt Prof. Dr. Christian Wiedermann, Internist und Koordinator der Forschungsprojekte des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health. Wiedermann warnt jedoch vor einer pauschalen Dramatisierung der Digital–Media-Risiken: „Es geht nicht darum, digitale Medien zu verteufeln, sondern vielmehr um das Fördern eines maßvollen Umgangs mit Digital Media, um mögliche negative Folgen des Konsums abzumildern“, so Wiedermann. „Unsere COP-S-Studie 2025 soll nicht nur auf vorhandene Probleme hinweisen, sondern will auch Lösungsmöglichkeiten und Handlungsansätze aufzeigen, um Politik und Gesellschaft bei der Entwicklung geeigneter Präventionsstrategien zu unterstützen“, ergänzt Dr. Verena Barbieri.
Die Ergebnisse der drei bisherigen Studien
An den ersten drei Befragungen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 nahmen jeweils zwischen 6.000 und über 9.000 Familien teil. „Das Institut für Allgemeinmedizin konnte mittels Zahlen belegen, dass Hinweise auf Angststörungen, Verhaltensauffälligkeiten und depressive Symptome nicht nur insgesamt im Laufe der Pandemie zugenommen haben und anschließend gleich geblieben sind, sondern es war dem Institut auch möglich, besonders vulnerable Gruppen zu identifizieren“, so Dr. Verena Barbieri. Betroffen waren vornehmlich Kinder von Eltern mit psychischen Belastungen, Kinder von Alleinerziehenden sowie in Teilen Kinder mit internationaler Geschichte. Ein weiteres alarmierendes Ergebnis: Mädchen sind stärker von Angststörungen betroffen als Buben. „Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen vermehrtem Konsum von digitalen Medien und mentalen Problemen. Daher wird die Erhebung 2025 diesen Aspekt vertieft untersuchen“, erläutert Barbieri. Problematisch ist hauptsächlich der Einfluss digitaler Medien auf das Selbstbild und das Körperbewusstsein der Jugendlichen. „Studien zeigen, dass Essstörungen vor allem bei Mädchen stark mit dem Konsum von Digital Media zusammenhängen und dass seit Beginn der Pandemie Essstörungen stark zugenommen haben“, unterstreicht Barbieri.
Corona ist noch immer ein Thema bei Südtirols Jugend
„Viele Kinder und Jugendliche fühlen noch immer die Last der COVID-19-Pandemie“, sagt Studienleiterin Dr. Barbieri. „Die Ergebnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass in Südtirol vor allem Hinweise auf Angststörungen (27%) und auf Verhaltensauffälligkeiten (28%) nach dem Ende der Pandemie 2023 keinen Rückgang verzeichnen konnten“. Forschungskoordinator Prof. Wiedermann sieht hier Handlungsbedarf: „Die langfristigen Corona-Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche sind nicht zu unterschätzen. Besorgnis erregend ist vor allem, dass viele Kinder weiterhin über Stress, Zukunftsängste und eine erhöhte psychische Belastung klagen“, gibt Prof. Christian Wiedermann zu bedenken.
Die COPSY-Studie in Deutschland
Ein Blick nach Deutschland zeigt eine ähnliche Entwicklung. „Die Ergebnisse der vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführten COPSY-Studie – im Herbst 2025 erfolgt die 8. Erhebung – dokumentierten, dass sich die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie bedeutend verschlechtert hat“, erläutert Prof. Christian Wiedermann. Obwohl es in den Folgejahren (2022/23) eine teilweise Erholung gab, liegen die Werte für psychische Belastungen weiterhin über dem Niveau vor der Pandemie. Stark betroffen sind Kinder und Jugendliche mit Zukunfts- ängsten, die ein erhöhtes Risiko für psychische Probleme aufweisen. „Da die ersten beiden Erhebungen der Südtiroler COP-S-Studie ähnliche Ergebnisse wie die deutsche COPSY-Studie zeigten, ist davon auszugehen, dass auch in Südtirol vergleichbare Lang- zeitfolgen bestehen“, so Prof. Wiedermann.

Teilnahme an der Studie in Südtirol
Die 4. Erhebung zu „Corona und Psyche in Südtirol“ wird vom 24. März bis 13. April 2025 in elektronischer Form durchgeführt. „Die Daten werden anonym über einen Online- Fragebogen erhoben“, erklärt Dr. Verena Barbieri. Der Fragebogen wird über die drei Südtiroler Landesschulämter an die Eltern aller Schüler:innen öffentlicher Schulen versendet. Er ist über einen Link zugänglich und kann wahlweise in deutscher oder italienischer Sprache konsultiert werden. Der erste Teil des Fragebogens wird von einem Elternteil ausgefüllt. „Sofern das Kind das elfte Lebensjahr bereits vollendet hat, darf es im Anschluss an den Elternfragebogen selbst noch einige Fragen beantworten. Insgesamt dauert das Ausfüllen des Fragebogens für die Eltern ca. zehn bis 15 Minuten und für die Jugendlichen zehn Minuten“, erläutert Studienleiterin Dr. Barbieri. Jede Familie sollte nur einmal an der Befragung teilnehmen. Der Fragebogen wählt zufällig eines der Kinder aus, auf das sich die Fragen beziehen. „Eine hohe Teilnahmequote hilft uns, verlässliche und repräsentative Daten zu gewinnen und klare Rückschlüsse zu ziehen“, betont Barbieri. Die Erkenntnisse der Studie sollen in politische und gesellschaftliche Maßnahmen einfließen.
Die Bedeutung der Gesundheitsbildung an Schulen
Die drei bislang in Südtirol durchgeführten COP-S-Erhebungen waren ein wichtiger Teil der Grundlagen für gezielte Maßnahmen im Bildungsbereich. „Psychologische Beratungs- dienste an Schulen wurden ausgebaut und sozialpädagogische Unterstützungsangebote verstärkt, um den erhöhten Bedürfnissen der Schüler:innen gerecht zu werden“, erklärt Prof. Christian Wiedermann. Seines Erachtens untermauern die objektiven Daten der COP-S-Studie zudem die Notwendigkeit einer gezielten Förderung der Gesundheits- kompetenz der jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft. „Es ist notwendig, Gesundheits- bildung vermehrt in den Lehrplan der Schulen zu integrieren und das Augenmerk auf Themenbereiche wie Ernährung und Bewegung, aber auch auf psychische Gesundheit und Digital–Media-Kompetenz zu legen“, bekräfigt Prof. Wiedermann. „Die Schule ist ein zentraler Ort für Prävention und Gesundheitsförderung“, ergänzt Dr. Verena Barbieri: „Hier können Kinder und Jugendliche lernen, ihr Gesundheitsverhalten zu hinterfragen und ihr Gesundheitsbewusstsein zu schärfen. Auch Eltern setzen sich in der Folge verstärkt mit diesen Themen auseinander. Die Schule ist zudem jener Ort, an dem gesellschaftliche Entwicklungen am frühesten erkannt werden können. Präventionsmaßnahmen können daher am besten im Rahmen einer produktiven Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- und Bildungssystem entwickelt und in die Tat umgesetzt werden“, schließt Dr. Barbieri.
Wichtig zu wissen: Die einzelnen Artikel des Gesundheitsblogs des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen werden nicht aktualisiert. Ihre Inhalte stützen sich auf Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Belege, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar sind. Gesundheitsinformationen aus dem Internet können eine persönliche ärztliche Beratung nicht ersetzen. Informieren Sie Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin über mögliche Beschwerden. Weiter…